Energy Sharing in Deutschland: Teilen von Strom erhält gesetzlichen Rahmen - Bündnis Bürgerenergie kritisiert weiterhin große Hürden
 © IWR / Schlusemann
© IWR / Schlusemann
Berlin - Der Bundestag hat mit dem neuen Paragraphen 42c im Energiewirtschaftsgesetz die Einführung von Energy Sharing in Deutschland beschlossen. Daran anknüpfend hat am Freitag letzter Woche auch der Bundesrat der Einführung des neuen EnWG-Paragraphen zugestimmt.
Erstmals wird damit ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der gemeinschaftlich erzeugten Strom über das öffentliche Netz an mehrere Abnehmer weiterleiten soll.
Grundgedanke des Energy Sharings ist, dass gemeinschaftlich erzeugter Strom aus erneuerbaren Anlagen von mehreren Verbrauchern genutzt werden kann, unabhängig von ihrem Standort oder Eigentumsverhältnissen. Damit soll Bürgerenergie breiter etabliert, die Akzeptanz dezentraler erneuerbarer Energien gestärkt und die Beteiligung der Bevölkerung an der Energiewende gefördert werden.
Das Bündnis Bürgerenergie (BBEn) begrüßt den jetzigen Schritt grundsätzlich, sieht aber weiterhin erhebliche Defizite. Valérie Lange, Leiterin Energiepolitik beim BBEn, erklärt: „Energy Sharing bietet entscheidende Vorteile gegenüber bisherigen Vor-Ort-Versorgungskonzepten: Erstmals kann der Strom über das öffentliche Netz über längere Distanzen hinweg geliefert werden. Das ist ein bedeutender Schritt, um Bürgerenergie in die Breite zu bringen.“ Gleichzeitig kritisiert der Verband die fehlende Wirtschaftlichkeit als Knackpunkt der neuen Regelung: „Es gibt keinerlei Anreize, die den zusätzlichen bürokratischen und messtechnischen Aufwand kompensieren“, so Lange.
Weitere Hindernisse sind aus BBEn-Sicht unklare Marktkommunikation, mangelnde Digitalisierung und uneinheitliche Datenformate. Zudem seien Bürgerenergiegemeinschaften nicht ausdrücklich als Berechtigte im Gesetz genannt, was Rechtsunsicherheit schaffe. Auch beim Mieterstrom bleibe die Lage angespannt, da die beschlossene Übergangsregelung für Bestandsanlagen nur kurzfristig Entlastung biete.
Nach Einschätzung des BBEn ist mit dem neu eingeführten EnWG-Paragraphen die Basis für das Energy Sharing gelegt. Doch für ein wirklich bürgerorientiertes, wirtschaftlich tragfähiges Modell sind weitere Schritte notwendig. Finanzielle Anreize, verbesserte Marktkommunikation und eine klare Einbeziehung von Bürgerenergiegemeinschaften sind entscheidend, damit das Modell praktisch funktioniert. Langfristig könnte Energy Sharing dazu beitragen, lokale Energieprojekte zu stärken, Bürgerbeteiligung zu erhöhen und die Energiewende dezentral zu gestalten - vorausgesetzt, gesetzliche und technische Rahmenbedingungen werden weiterentwickelt.
© IWR, 2026
EJ: BBH Consulting AG sucht (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung Green Value begleitet Transaktion: Green Value GmbH unterstützt Balance Erneuerbare Energien GmbH bei Kauf von Biogas-Portfolio
Statkraft erreicht Meilenstein in Großbritannien: Statkraft und Emsys VPP setzen mit 300-MW-Batteriespeicher „Thurrock“ auf Flexibilisierung
Reform der Netzentgelte für Stromerzeuger: BDEW setzt auf Baukostenzuschüsse – BNetzA favorisiert dynamische Netzentgelte für Stromeinspeiser
Führungswechsel beim Bundesverband Erneuerbare Energie: Dr. Christine Falken-Großer wird neue BEE-Hauptgeschäftsführerin
Green Plains kehrt zur Profitabilität zurück: Green Plains meldet Gewinn und starkes EBITDA im vierten Quartal 2025
Das könnte Sie auch noch interessieren
Gewerbestrom - Strom-Anbieter wechseln
Jobticker - Neuzugänge Energiejobs
Stromrechner - Anbieter wechseln und Geld sparen
25.11.2025
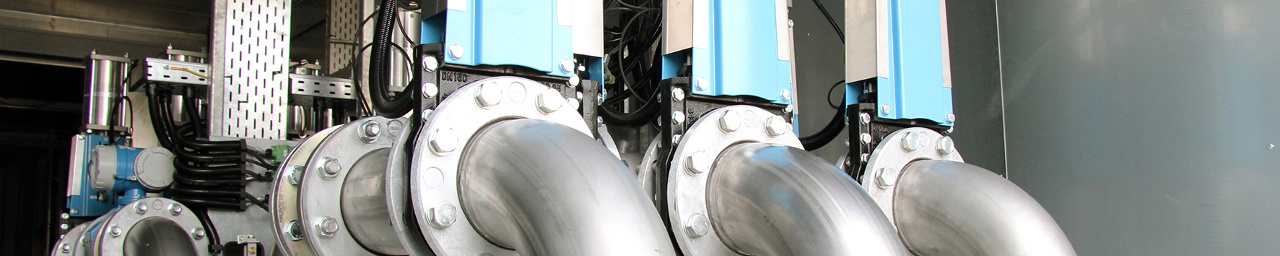
 Artikel teilen / merken
Artikel teilen / merken


